Förderung: gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Laufzeit: 2018-2023
Städte gelten als Orte der Inklusion. Weniger Beachtung gefunden hat bislang die wachsende Vielfalt der Mechanismen urbaner Migrationskontrolle, die Städte auch zu Orten der Exklusion machen. Das Projekt untersucht städtische Politiken und Praktiken urbaner Migrationskontrolle und wie Migrant_innen diese erleben, mit anderen Worten, es analysiert die Entstehung urbaner Grenzräume in Europa.
Während Studien zur Migrations- und Grenzkontrolle vorwiegend die nationale und zunehmend die europäische Ebene untersuchen, zeigen die Vorarbeiten für dieses Projekt, dass städtischen Behörden und nicht-staatlichen Akteuren hier große Bedeutung zukommt, beispielsweise durch Identitätskontrollen auf städtischen Straßen oder durch Prüfung des Aufenthaltsstatus durch die sozialen Dienste. Um diese Forschungslücke zu schließen, nutzt und integriert dieses Projekt drei bislang kaum verbundene Forschungsstränge, nämlich die städtische Migrationsforschung, die urbane Inklusion und Bürgerschaft untersucht, aber die Frage der Grenze ignoriert; die Grenzforschung, die die tiefgreifenden Transformationen der Grenze herausarbeitet, aber kaum die Rolle der Städte thematisiert und die Stadtforschung, die sich mit urbanen Transformationen befasst, sich aber selten der Grenze widmet. Die Unverbundenheit dieser Forschungsperspektiven hat dazu geführt, dass die urbanen Aspekte der jüngeren Grenztransformationen weitestgehend unberücksichtigt blieben, aber hohe Bedeutung besitzen für die In- und Exklusion von Migrant_innen in europäischen Städten.
Das Projekt fokussiert die Forschungslücke hinsichtlich urbaner Migrationskontrolle und fragt (a) in welcher Weise Städte in der Migrationskontrolle aktiv sind; (b) wie Migrant_innen urbane Migrationskontrolle erleben; und (c) wie Unterschiede zwischen Städten erklärt werden können. Darüber hinaus soll empirisch und theoretisch herausgearbeitet werden, (d) in welchem Verhältnis urbane Bürgerschaft und Kontrolle zueinander stehen. Diese Fragen werden mit Hilfe qualitativer Sozialforschung anhand eines Städtevergleichs bearbeitet. Das Design basiert auf der Annahme, dass die Position einer Stadt in der globalen Städtehierarchie und der Grad ihrer globalen Vernetzung urbane Migrationskontrolle beeinflussen. Die Forschung wird in zwei Global Cities, Frankfurt am Main und Madrid, und zwei weniger globalisierten Städten, Dortmund und Bilbao, durchgeführt und nutzt offizielle Statistiken, Dokumente, Leitfaden-gestützte Interviews mit Vertretern lokaler Behörden und anderer relevanter Organisationen sowie narrative biographische Interviews mit Migrant_innen.
Das Projekt leistet einen Beitrag zum empirischen und theoretischen Verständnis von Städten und urbanen Räumen in der sich verändernden räumlichen Organisation der Grenze in Europa. Dies wird helfen das Zusammenspiel von Inklusion und Exklusion, von (urbaner) Bürgerschaft und Kontrolle und ihre Rolle für das Leben von Migrant_innen in europäischen Städten besser zu verstehen.
Das Projekt wurde zwischen 2018 und 2023 an der Universität Bielefeld, der Hochschule Darmstadt und der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt.
Prof. Dr. Margit Fauser | Principal Investigator
Elena Fattorelli | Researcher (2020-2023)
Corinna Angela Di Stefano | Researcher (2020-2022)
Katharina Mach | Student Research Assistant (2023)
Deborah Balts | Student Research Assistant (2020-2021)
Sarah von Querfurth | Student Research Assistant (2018-2019(
Nathale Nelo Martins | Student Research Assistant (2018-2019)
Ole Oeltjen | Researcher (2018-2019)
Special Issue: Mapping the internal border
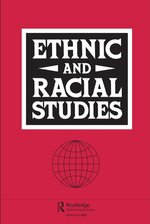
This Special Issue showcases the shift of the border from the external line toward diverse sites and actors within the territory of the state and explores how this specifically concerns the city and the urban space. In other words, it offers a mapping of the internal border.
This editorial introduces the concept of the internal border through some key conceptual figures and main themes that provide elements for its theorisation, some of which are further examined by the contributions of this Special Issue.
Special Issue: Migrations and border processes: politics and practices of belonging and exclusion from the 19th to the 21st century
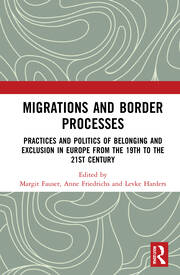
Current media images of a “fortress Europe” suggest that migrations and borders are closely connected. This special issue brings together scholars from history, sociology and anthropology to explore cross-border mobility and migration during the formation, development, and transformation of the modern (nation-)state explicating the conflictive and fluctuating character of borders. The historical perspective demonstrates that such bordering processes are not new. However, they have developed new dynamics in different historical phases, from the formation of the modern (nation-)state in the nineteenth century to the creation of the European Union during the second half of the twentieth.
Reprint:
Margit Fauser, Anne Friedrichs & Levke Harders (eds), 2021, Migrations and Border Processes: Practices and Politics of Belonging and Exclusion in Europe from the Nineteenth to the Twenty-First Century. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781003141570.